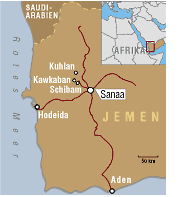|
 |
|
 |
|
|
|
Artikel aus der "ZEIT" (www.zeit.de) vom 1. Februar 2001
Shakespeare, gefährlich abgedreht
|
 |
 |
|
|
Schauplatz: Nordjemen. Hier lässt der Berliner Autor und Regisseur Michael Roes den alten "Macbeth" spielen. Zwischen Kat und Kalaschnikows - eine Begegnung in Kawkaban
Von Tomas Niederberghaus

|

|
Fotos: Manfred Andrej Hagbeck (o.)/
Tomas Niederberghaus (u.)
|
Wenn die Nacht im Streit mit dem Morgen liegt und der Ruf des Muezzins vom Gebell der streunenden Hunde zerrissen wird. Wenn die Kälte wie eine Bestie ins Zimmer kriecht. Wenn der Albtraum zum Verbündeten des Traums wird. Mit jedem Tag erwacht im Jemen dann ein neues Risiko, ein neuer Konflikt, der Stimmungen und Seelenprozesse auslöst, die man als Reisender aus anderen Ländern kaum kennt. Es ist nicht das Gewusel, das Geschrei, das Gehupe, das Gemecker und das Gedränge in den Gassen Sanaa's, das die westlichen Koordinaten außer Kraft setzt. Gestern hielt mir einer sein geladenes Gewehr in den Rücken. Und nun, im sonnengedörrten Irgendwo aus Lehm, Sand und Geröll, reißt Ali plötzlich wie besessen das Steuerrad zur Seite. Der Landcruiser stoppt, und als der Staub der Bremswolke langsam abzieht, steht Ali in einem Kreis von zehn bis zwölf Stammeskriegern. Die Männer tanzen, schultern schwere Geschosse und recken die blitzenden Klingen ihrer Krummdolche zum Himmel. Bar'a nennt sich dieser Kriegstanz. Ein dicker Jemenit und sein Sohn geben trommelnd den Takt an.
Der Berliner Schriftsteller Michael Roes hat das Phänomen bar'a in seinem Jemen-Roman Rub' Al-Khali. Leeres Viertel anschaulich analysiert. Dieser Tanz, schreibt Roes, spiegele das Selbstverständnis der jemenitischen Stammeskrieger wider. Für die Stämme besitze der Krieg auch eine Art Ästhetik, "die Fortsetzung des Tänzerischen in der kriegerischen Begegnung". Kompromisslos hat Roes den Jemen für seine ethnologischen Studien bereist. Er ist der intellektuelle Berserker, der nichts und niemanden schont, schon gar nicht sich selbst. Das Leere Viertel hat Michael Roes den Bremer Literaturpreis eingebracht. In diesen Wochen reist der "Monomane der deutschen Gegenwartsliteratur" (ZEIT) erneut durch den Jemen. In den Bergdörfern des Nordens dreht er ein eigenwilliges "Macbeth"-Projekt. Und wenn Ali nicht bis zum Umfallen bar'a tanzt, könnten wir in einigen Stunden am Drehort in Kawkaban sein. Aber im Jemen ist nichts gewiss, nur der Tod.
Ali ist ein Haudegen. Hennarot gefärbte Haare, graue Bartstoppeln auf sonnengegerbter Haut, Krummdolch, Parka, rote sumata. Was Ali seit heute früh schon an Kat in seine Backe gestopft hat, würde einem Kamel als Grünfutter für eine Woche ausreichen. Diese Droge, die so bitter schmeckt wie zuckerfreier Hustensaft, lässt ihn zum Rambo der Straße werden. Auf der Weiterfahrt Richtung Schibam lehnt er sich aus dem Fenster, um Entgegenkommenden zuzugrölen. Er wechselt die Fahrspuren, die es ohnehin gar nicht gibt, und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dieser Mann wolle sich auf dem Asphalt dafür rächen, dass sein Land jahrhundertelang mit Eseln auskommen musste. Nur am Checkpoint am Rande Sanaa's riss Ali sich zusammen. Zwei düster blickende, schwer bewaffnete Männer kontrollierten unseren Passierschein. Seit der letzten blutigen Entführung im Jahre 1999 kommt kein Tourist ohne Genehmigung aus der Hauptstadt raus. Das Militär bietet Begleitschutz an. Vor allem im Norden und Nordosten des Landes rechnet die Regierung immer wieder mit Kidnappern. Entführungen sind Ehrensache. Tradierte Werte, fest in der Kultur verankert. Sie haben den Jemen möglicherweise davor bewahrt, vom Massentourismus korrumpiert zu werden.
Auf 18 Millionen Jemeniten kommen 64 Millionen Gewehre
Schibam liegt am Fuße eines gigantischen Tafelberges. Ein Fremder ist hier noch so fremd, dass er die Kinder im Dorf entweder magisch anzieht oder sie verscheucht. Ich laufe durch ein Stadttor mit Inschriftensteinen, passiere eine Moschee und erreiche oberhalb des Ortes den alten Eselspfad, der auf den Gipfel des Berges, nach Kawkaban, führt. In der Ferne sind kegelartige Felsformationen zu erkennen. Schwarze Ziegen klettern umher. Und ganz oben steht ein Kastell. Die Macbeth-Burg? Krähen kreisen vor den Felsen wie Shakespeares Boten des Schreckens. Plötzlich fallen Schüsse. Im Kugelhagel der Kalaschnikows lasse ich mich zu Boden sinken. Und während ich so blöd daliege, entdecke ich im Tal zwei Jungs, die auf die Vögel ballern. Eine Kalaschnikow trägt man im Nordjemen wie in New York die Prada-Tasche. Auf 18 Millionen Jemeniten kommen 64 Millionen Gewehre und Pistolen.
Shakespeares Macbeth ist die Geschichte eines Machtbesessenen, das ist bekannt. Es geht um die Natur des Bösen und darum, dass sich Verbrechen nicht auszahlt. Der Norden Jemens bietet dafür eine grandiose Kulisse. Ein mystischer Schauplatz, fast 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Eine Landschaft, die nie grün wird und auch nicht weiß, die so absolut und namenlos daherkommt, schroff abweisend, aber nicht seelenlos, die keimfrei ist wie ein Operationssaal. Ein Ort, an dem Tugenden wie Ehre, Gastfreundschaft und Blutrache so grundlegend sind wie im Westen eine Mitgliedschaft bei Visa oder AOL. Tugenden, die auch Shakespeare in Macbeth thematisiert.
Kawkaban. Michael Roes ist kaum zu erkennen. Mit seinem grauen Dreieckstuch gleicht er einem modernen Lawrence von Arabien. Seit vier Wochen dreht er. Die Strapazen haben sich als tiefe Furchen ins Gesicht des 40-jährigen Autors gegraben. "Wir haben kafkaeske Situationen erlebt", sagt er. "Als wir ankamen, haben sie uns die Drehgenehmigung wieder entzogen, tagelang durften wir Sanaa nicht verlassen. Und unser Begleiter vom Informationsministerium hielt die Hand auf, korrupt bis auf die Knochen." Roes sagt das enttäuscht und wütend, während wir über eine buckelige Staubpiste zum Empfang beim Scheich laufen. Wenige Minuten später betreten wir einen riesigen Diwan. Rund 40 Honoratioren sitzen im Kreis, die Backen mumpsdick. Selbst die zahnlosen Alten schieben sich das Kat klein gemahlen in den Mund. Der Scheich zieht an einer Wasserpfeife, deren Schlauch wie eine Boa constrictor im Raum liegt. Ahmad al-Hisam, Roes' Übersetzer, stellt die Crew und das Projekt vor. Einmal wird er unterbrochen: Da zischeln die Männer den Namen Shakespeare, als würde der Meister gleich wie ein Ungeheuer aus der Dorfzisterne auftauchen. Oder als wüssten sie, dass über dem Stück ein Fluch liegt, wie es bei Theaterleuten heißt, weshalb man dort das Wort Macbeth gar nicht ausspricht.
Roes hat für die Recherche seines Romans bereits ein Jahr im Jemen gelebt. Er weiß, wie wichtig die Rückendeckung der Stämme ist. "In Thafir", sagt er, "hat eine Gruppe im Ort uns mehrfach beschossen. Die Kugeln prallten knapp über unseren Köpfen an einer Wand ab." Die Lage sei zu riskant gewesen, um dort weiterzudrehen. Gerade in dieser konservativsten Gegend des Landes, Geburtsort von Präsident Ali Abdallah Saleh, herrscht zuweilen noch immer Stammesrecht vor Staatsrecht. Es ist ein System von Familienverbänden, hoch komplex. Alte Fehden werden von neuen abgelöst, längst vergessene wiederbelebt. Wer sich auf die falsche Seite schlägt, kann erschlagen werden. Aber Kawkaban ist nicht Thafir. Hier ist der Empfang herzlich. Ein Junge singt mit kehliger Stimme und schweißnasser Stirn. Die Alten bilden den Chor. Ein Moment der Sinnlichkeit.
Someone is sleeping in my pain nennt Roes sein "Macbeth"-Projekt. Der Titel spielt auf die widrigen Umstände des Drehs an. Aber dieser Film lebt von Fallen und Fallstricken, sie machen ihn zu einem Abenteuer der besonderen Art. Und die Dokumentation des Abenteuers wird - als Teil des Films - immer wieder eingeblendet werden. Das "Macbeth"-Stück selbst dreht Roes in Schwarzweiß. Einziger professioneller Hauptdarsteller ist der New Yorker Afroamerikaner Andrea Smith, 34 Jahre alt. Weitere Rollen übernehmen jemenitische Laien. Smith spielt einen Regisseur, der in den Jemen reist, um Shakespeare aufzuführen. Die Regierung in Sanaa hat Michael Roes zur Auflage gemacht, keine Frauen zu filmen. Ergo wird Lady Macbeth von einem Mann (ebenfalls von Smith) gespielt, was durchaus der Tradition des elisabethanischen Theaters entspricht. Und Jahja, dieser hübsche Macbeth mit den hohen Wangenknochen und dem verzauberten Blick, hat kein Problem, sich dieser Lady anzunehmen. Außerhalb des Drehs spaziert er mit Smith Hand in Hand durch das wilde Kawkaban.
Aber ist diesem sanften Krieger zuzutrauen, den König zu ermorden? "Ohne Kat kann ich nicht spielen", droht Jahja wie eine Diva. Der Nachschub kommt, und Jahja verfällt dennoch in Schwermut. Zwei Männer fahren den tränenüberströmten Jemeniten nach Hause. Roes muss die Macbeth-Rolle vorübergehend neu besetzen. Filmen heißt hier improvisieren. Die Konditionen sind ohnehin strapaziös. Tagsüber Sommer, nachts Winter, Schlafen im spartanischen Bettenlager, keine Dusche, kein Bad. Und wenn die Bronchien rasseln und man beim Frühstück vor dicken Bohnen sitzt, kann man Jahjas Depression wirklich verstehen.
Der Königsmord ist eine schöne Szene. Mondlichtübergossen liegt die Macbeth-Burg am Abhang von Kawkaban, tausendundein Sterne funkeln am Himmel. Zum Diwan in der oberen Etage führt eine schmale Treppe, in deren Stufen die einstigen Bewohner eine tiefe Geschichte getreten haben. König, Prinz und Macbeth sitzen im Kerzenlicht, speisen. "Vielleicht sollten wir mehr ausleuchten", sagt Kameramann Manfred Andrej Hagbeck. "Wir sind hier nicht in Hollywood", entgegnet Roes und rückt Hagbeck in die gewünschte Position.
Enge Käfige. Die Affen toben
Klappe. Macbeth wird vom Zweifel überfallen. Er läuft in den Innenhof, um sich von Lady Macbeth zur Tat animieren zu lassen. "Schraubt nur Euren Mut so hoch es geht ...", sagt sie. Eine Stunde später betritt Macbeth die Königskammer. Doch der König kapiert die Regie nicht. Statt im Schlaf leise bis drei zu zählen und dann die Augen aufzureißen, um in das verstörte Gesicht Macbeths zu blicken, hält er die Augen zu und zählt und zählt und zählt. Roes setzt hier ganz auf Symbolik. Er zeigt nicht den Königsmord, sondern schwenkt auf die dokumentarische Ebene: Vor der Kamera wird einem Lamm die Kehle durchgeschnitten. Auch die Schlacht wird verfremdet: In den engen, rostigen Käfigen des Zoos in Sanaa gehen Affen aufeinander los.
Kawkaban ist der Rest eines Dorfes. Zahlreiche Häuser wurden im Bürgerkrieg 1962-69 zerbomt. Einige Krater sind noch zu sehen. Mitten im Ort erheben sich die grauen Betonpfeiler einer Zivilisationsruine. Nebenan sitzt ein Greis in einer Werkstatt. Die Werkstatt hat die Größe einer Duschkabine. Würde man die marode Holztür entfernen, fiele sie wie ein Kartenhaus zusammen. Der Alte schaut kurz herüber, aber ich glaube, er sieht mich nicht. Seine Augen sind milchig, nur seine Hände schneiden, schleifen und stanzen, als sei er 17. Am Ende dieser Arbeit wird er an die Tür eine Schere hängen. So etwas vermutet man eher im Museum für Völkerkunde als im Haushalt.
 | 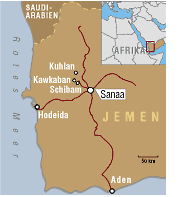 | ZEIT-Grafik
|
Er habe diesen Film jahrelang vorbereitet und noch länger davon geträumt. "Das schottische Mittelalter ist jemenitische Gegenwart", sagt er. "Hier muss man einfach spielen." Die Arbeit ist für Michael Roes wie eine Droge. Man braucht nicht lange, um zu erkennen, dass er sich an Pasolini misst, und daran wird er sich nach der Premiere des Films messen lassen müssen. Wie der italienische Autor und Regisseur übersetzt Roes die Geschichte ins Mittelalter, inszeniert die Bilder, setzt das Nichtprofessionelle bewusst als Stilmittel ein und wählt als Darsteller die hübschesten Männer, die er bekommen kann.
Lady Macbeth fällt in Ohnmacht
Lady Macbeth ist heute ganz in Schwarz gekleidet. Wir sind auf dem Weg nach Kuhlan, rund 30 Kilometer nördlich von Kawkaban. Serpentinen, Pässe, Bergterrassen. Irgendwann durchqueren wir die Provinzhauptstadt Amra. Der einzige Fortschritt in Amra ist ein Zementwerk. Der Fortschritt speit schwefelfarbenen Staub aus, der sich mit dem schwarzen Ruß der Lkw mischt und als Dunstwolke über der Stadt hängt. "Wahrscheinlich ein Entwicklungshilfeprojekt, dem zum Schluss das Geld für die Filteranlage fehlte", sagt Lady Macbeth lapidar und genervt.
Kurz vor Kuhlan steuern wir ein Restaurant an, das einzige weit und breit. Die Tische verklebt, Katzen vertilgen Essensreste auf weinroten Plastikstühlen, Töpfe und Schüssel haben weder Wasser noch Lappen gesehen. Das sind die Szenen, die man gern im Kino sieht und sich dabei denkt: "Schön, dass du das nicht erleben musst", und jetzt ist man selbst Teil dieses Wahnsinns. Trotz allem ist das Restaurant ein begehrter Ort. Jeeps fahren vor. Männer steigen aus, kaufen selta, jemenitischen Gemüseeintopf, den sie durch die halb geöffneten Scheiben ihren Frauen ins Auto reichen. Nur Männer speisen öffentlich. Der westliche Magen stülpt sich nun auf links. Aber an der Landschaft kann man sich kaum satt sehen.
Kuhlan ist ein Beispiel dafür, dass den Jemeniten kein Berg zu hoch ist, um eine Stadt zu errichten. Die Festungstürme sind an den Hang gemauert. Ein Felsennest, unter dem die Bergwände bis zu 2000 Meter steil ins Tal abfallen. Ein Wächter öffnet uns den alten Imamspalast. Marode Mauern, brüchige Decken, Vogelnester. Ideal für "Macbeth". "Seit 20 Jahren lese ich hier den Koran", sagt der Wächter und schaut den Dreharbeiten gespannt zu. Lady Macbeth ist noch nicht in Ohnmacht gefallen, und als Macbeth auf dem Teppich sitzt und einen jungen Hund streichelt, verlässt der Wächter die Gemäuer. Minuten später erscheint ein Sicherheitschef. Im Ort heißt es, Roes würde die Anbetung von Hunden filmen. Das Team muss Kuhlan bei Nacht und Nebel verlassen.
Natürlich fährt mich Ali zurück nach Sanaa. Gewohnt tollkühn. Wie verarbeitet man solche Bilder? Wie ordnet man dieses wirre Gemisch fremder Eindrücke? Wie viele Erlebnisse reichen für einen Kulturschock? Stunden später laufe ich durch Sanaa's märchenhaft anmutende Altstadt und verschwinde in den Katakomben eines Hamams. Michael Roes hat hier eine Traumszene gedreht. Ein junger Mann nimmt mich an die Hand und führt mich in einen schummrigen Raum, seift mich ein und holt einen eingedellten Farbeimer mit Wasser, das er mir langsam über den Kopf schüttet. Es riecht nach Muff und Moder, die Feuchtigkeit hat die Türen handbreit angefressen. Der junge Mann heißt Muhammed. Massage?, fragt er. Ich nicke, lege mich auf die heißen Steine. Muhammed hüpft auf meinem Körper herum. Draußen bellen die Hunde. Und der Muezzin ruft auch schon wieder. Muezzine, sagt man, haben die kräftigsten Stimmen der Welt.
>> Artikel der "Berliner Morgenpost"
>> Artikel im "Yemen Observer" (in Englisch)
>> Interview mit dem Regisseur (in Englisch)
|
    |